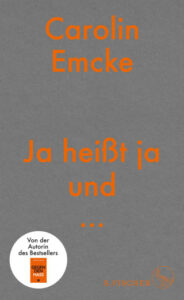
Gesprächsräume öffnen jenseits der Lagerbildung. Bild: S.Fischer
Macht und Lust, geht das noch zusammen? Unter dem Hashtag „MeToo“ ist 2017 eine Bewegung ins Rollen gekommen, die sexuelle Übergriffe in die Öffentlichkeit gehoben und durch den Mut der Opfer, offen über die Erfahrungen zu sprechen, Namenlosigkeit und Scham gebrochen hat.
Seitdem ist die Debatte aus dem öffentlichen Diskurs nicht mehr wegzudenken. Wie sprechen wir über Dynamiken, Machtmissbrauch, Sexualität und Gleichberechtigung? Wie schaffen wir es, einen ausgeglichenen Dialog zu kreieren, der aufmerksam, aber nicht negierend ist? Wie spüren wir Gewaltpotenziale auf und verhindern sie? Wie können wir einen Diskurs über Bedürfnisse aller Facetten ermöglichen?
Die Publizistin Carolin Emcke befasst sich in diesem Text mit gesellschaftlichen Bildern, die uns prägen, die unser Verständnis von Lust und Unlust zeichnen, Normen, die wir erfüllen und Strukturen, in die wir uns einpassen sollen. Angelehnt an den Grundsatz aus dem verschärften Sexualstrafrecht von 2016, „Nein heißt Nein“, läuft Emcke eigene Erinnerungen ab, befragt Musik, Kunst, Literatur nach dem Spannungsfeld von Wahrheit und Lust, stellt in den Raum, stellt aus, wem in solchen Diskursen Gehör geschenkt wird und wem nicht; sie geht der Komplexität von Kommunikationsmustern auf den Grund und beleuchtet, wie blind artikulierte Emotion einer geregelten Auseinandersetzung jeglichen Nährboden entzieht. Mit dem Titel „Ja heißt ja und …“ geht Carolin Emcke darauf ein, wie existenziell der geregelte Dialog über Sexualität und Wahrheit unter der Prämisse der Wahrung persönlicher Grenzen aller Beteiligten für ein friedvolles gesellschaftliches Zusammenleben ist und weist damit gekonnt alle jene in die Schranken, die nach „MeToo“ meinen, „man könne ja gar nichts mehr sagen“.
Das Buch ist auf der Seite der S. Fischer Verlage für 15,00 Euro in der gebundenen Version erhältlich.

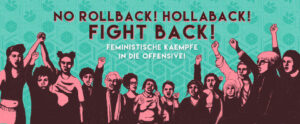

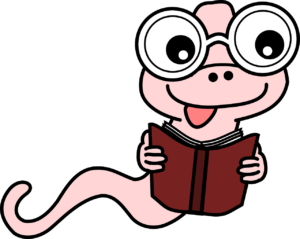

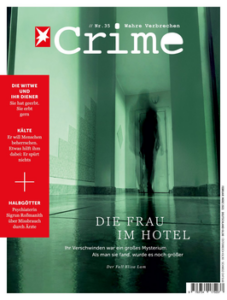 Die dunkle Seite des menschlichen Verhaltens strahlt eine seltsame Anziehungskraft aus. In einer Gesellschaft, in der ein moralisches Gleichgewicht angestrebt und durch Gesetze umgesetzt wird, sind Verstöße gegen diese Ordnung erschreckend, aber auch faszinierend. Verbrechen wie Mord oder Missbrauch sind abstoßend und doch übt der Blick auf das Wieso einen Reiz aus. Wer ist der Täter? Gibt es Gründe, wieso er so gehandelt hat? Was für ein Mensch tut einem anderen Menschen so etwas an?
Die dunkle Seite des menschlichen Verhaltens strahlt eine seltsame Anziehungskraft aus. In einer Gesellschaft, in der ein moralisches Gleichgewicht angestrebt und durch Gesetze umgesetzt wird, sind Verstöße gegen diese Ordnung erschreckend, aber auch faszinierend. Verbrechen wie Mord oder Missbrauch sind abstoßend und doch übt der Blick auf das Wieso einen Reiz aus. Wer ist der Täter? Gibt es Gründe, wieso er so gehandelt hat? Was für ein Mensch tut einem anderen Menschen so etwas an?


